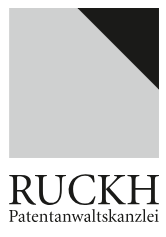Leicht kitzelt der Puderzucker auf dem Stollen in der Nase, es duftet nach Zitronat, Orangeat und vielleicht auch ein wenig nach Butter, Mohn oder Mandeln. Dazu eine frisch aufgebrühte Tasse Tee oder ein Kaffee - und schon ist er fertig, der perfekte Adventsnachmittag. Für viele Menschen ist der Christstollen eine der kulinarischen Liebhabereien der Weihnachtszeit. Und wer genau hinhört, der kann vielleicht sogar die Rosinen flüstern hören - dazu später aber mehr.
Von dicken Decken und Puderzucker
Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die Geschichte dieses so geliebten Weihnachtsgebäcks - welches einst sogar den Papst auf den Plan rief. Hergestellt wird Stollen aus einem Hefe-Feinteig, der mit Trockenobst, Mohn oder auch Marzipan gefüllt wird und der, und das dürfte nun manchen überraschen, das ganze Jahr über hergestellt und verkauft wird. In der Adventszeit erhält der Stollen eine dicke Schicht aus Puderzucker und wird so - zum Christ- oder auch Weihnachtsstollen. Der Name Christstollen soll sich davon ableiten, dass der dick mit Puderzucker bedeckte Stollen an das Jesuskind erinnert, welches dick in weiche Decken gehüllt würde.
Wie Bäcker gegen die Fastenzeit verstießen
Das älteste schriftliche Zeugnis, welches sich mit dem Stollen beschäftigt, stammt aus dem Jahr 1329. Das Schriftstück benennt die Innungsprivilegien der Bäcker in Naumburg (Saale). Die Zutaten, die damals verwendet wurden, haben jedoch nichts mit den feinen und durchaus nicht ganz günstigen Zutaten zu tun, die heute verwendet werden. Die sächsische Stadt Torgau ist ebenfalls eine Hochburg des Stollens. Seit 1457 wird dort Stollen gebacken - womit sich die Torgauer Bäcker jedoch den Zorn der Kirche zuzogen. Denn: Zur damaligen Zeit war die Zeit vor Weihnachten eine Fastenzeit, ganz im Gegensatz zu heute - während der es verboten war, Butter für die Zubereitung von Speisen zu verwenden. Doch genau von dieser gaben die Bäcker reichlich in den Stollenteig. Und das aus gutem Grund: Denn das sonst zu dieser Zeit in Sachsen verwendete Rübenöl verlieh dem Stollen keinen feinen Geschmack und nagte zudem auch an dessen Haltbarkeit.
Dem Streit zwischen Bäckern und Kirche wollten eines Tages zwei Herren ein Ende setzen: Kurfürst Ernst und sein Bruder Herzog Heinrich setzten sich zusammen, um einen Brief an den damaligen Papst Innozenz III zu verfassen. Sie schilderten darin ihre Lage, führten aus, warum Stollen mit Rübenöl nun wirklich kein Genuss sei und ob es nicht noch möglich wäre, Butter für den Stollen zu verwenden auch in der Zeit vor Weihnachten. Es dauerte auch nur ein paar Jahre und schon erhielten die beiden Brüder Antwort aus Rom: Der Papst hatte sich ihres Anliegens angenommen und erlaubte den Bäckern in Sachsen und zwar nur dort das ganze Jahr über Butter für ihre Stollen zu verwenden. Sein Schreiben wurde als „Dresdner Butterbrief“ von 1491 bekannt. Das hatte zur Folge, dass zum einen der Stollen aus Sachsen besonders gut schmeckte, denn überall anders musste weiterhin Öl verwendet werden, und zum anderen, dass in Rom die Kasse klingelte. Denn der Papst hatte verfügt, dass für die Verwendung von Butter während der Fastenzeit eine Gebühr fällig werde. Nun herrschte lange Zeit Ruhe in Deutschlands Bäckereien - bis zum Jahr 1615, als im Sächsischen der „Stollenkrieg“ ausbrach. Der Ort war seit dem Mittelalter für seinen Stollen bekannt. Jedes Jahr vor Weihnachten bekam jeder Ratsherr in Dresden zwei Siebenlehner-Stollen geschenkt. Damit schworen sie aber den Zorn der Bäcker aus Meißen auf sich. Waren die doch der Meinung, dass ihr Stollen genauso gut, wenn nicht gar noch besser wäre, als der aus Siebenlehn. Und auch den Dresdner Bäckern waren die Kollegen aus Siebenlehn ein Dorn im Auge. Zu dieser Zeit hatte Dresden in Sachen Stollen noch nicht die heutige Reputation. Und so kam es gar nicht so selten vor, dass Bäcker aus Siebenlehn von Bäckern aus Dresden in dunkle Gassen gezerrt und verprügelt wurden. Der Streit erreichte dann seinen Höhepunkt, als Bäcker aus Meißen den Sieblehnern mit Brandfackeln den Zutritt nach Dresden verbieten wollten. Der Streit der drei Städte dauerte bis zum Ende des Krieges Dreißigjährigen (1618-1648). Dann nämlich wurde ein Gesetz erlassen, das Bäckern von außerhalb Dresdens untersagte, während der Zeit des Striezelmarktes die Stadt zu betreten. Diese Regelung legte den Grundstein für Dresden als Stollen-Stadt.
Feinheiten aus Abend- und Morgenland
Lecker war der Stollen ja schon immer. Doch zu seinem wahren Ruhm kamer erst ab dem 15. Jahrhundert, als nämlich der Gewürzhandel Fahrt aufnahm und die Bäcker somit Zugriff auf Feinheiten wie Zimt, Kardamom oder Nelken hatten. Achso, da war ja noch die Sache mit den Rosinen. Seit über 100 Jahren haben Kinder in Sachsen ganz eigene Namen für den Stollen und nennen diesen, je nach Menge der enthaltenen Rosinen, Schrei- oder Flüsterstollen. Warum? Nun, weil bei einem Flüsterstollen so viele Rosinen drin sind, dass diese so eng beieinander liegen, dass sie sich im Flüsterton unterhalten könnten. Wohingegen bei einem Schreistollen mit wenig Rosinen ganz schön geschrien werden müsste, um sich mit umliegenden Rosinen zu unterhalten.
Von Anne Schur