Auf den ersten Blick liest sich die Nachricht wie eine Erfolgsmeldung: Nach Angaben des Photovoltaik-Netzwerks Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr Solaranlagen mit einer Leistung von 2.234 Megawatt zusätzlich ans Netz gegangen. Damit ist der Ausbau der Photovoltaik (PV) im Bundesland bereits das siebte Jahr in Folge angestiegen. Auch im laufenden Jahr sprechen die Zahlen dafür, dass die Zielmarke von 1.150 Megawatt erneut übertroffen wird.
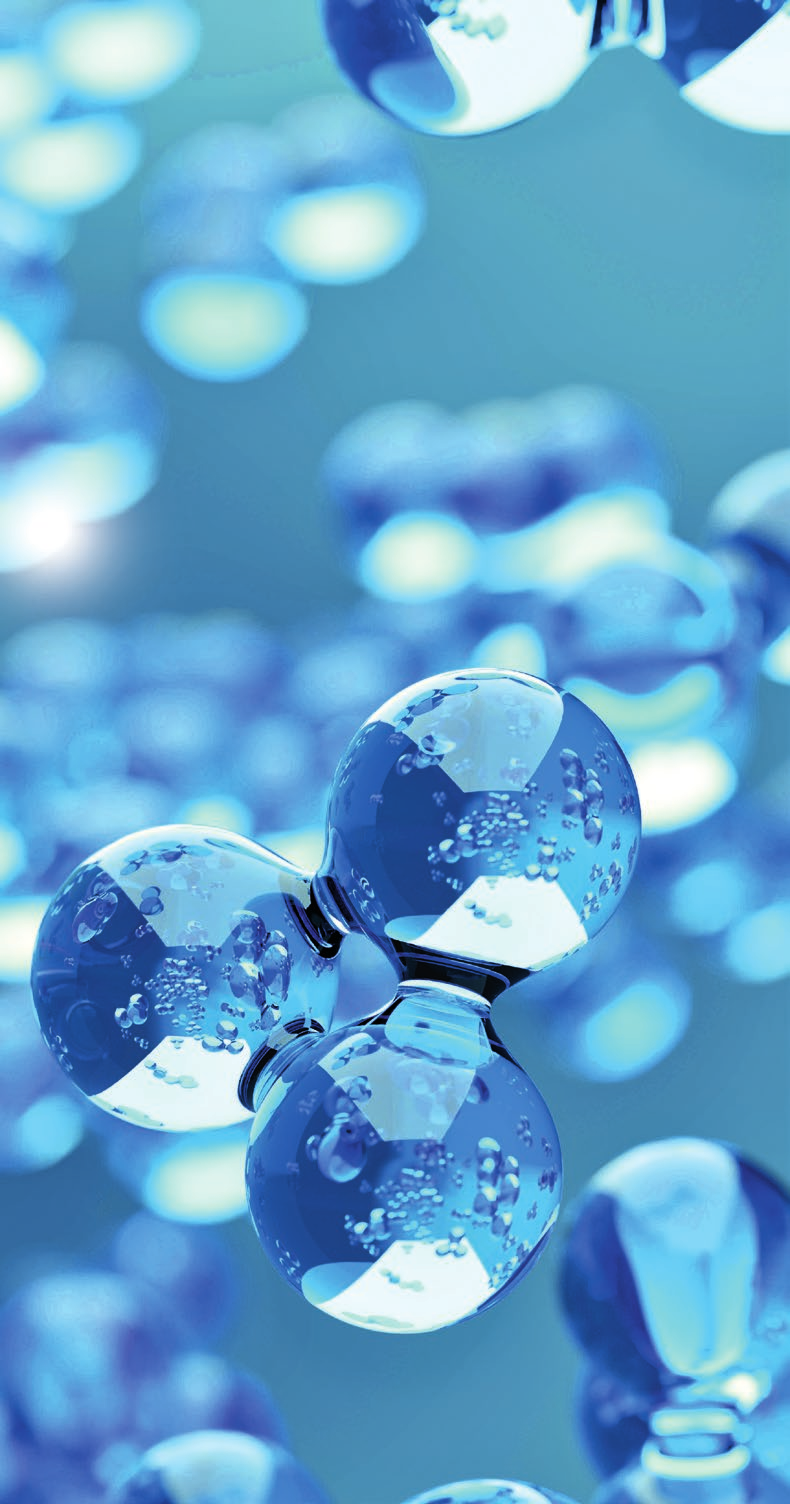
Doch der Solar-Boom hat seine Schattenseiten: Immer öfter müssen Windräder angehalten oder die Verbindung von PV-Anlagen abgeregelt werden, weil das Stromnetz überlastet ist und der viele grüne Strom einfach nicht gebraucht wird. Das hat auch Folgen für den Preis. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres fiel die Notierung an der Strombörse an 457 Stunden - also an fast 20 Tagen - unter null Euro. Ein neuer Rekord. Die ersten Netzbetreiber im Land ziehen daher die Notbremse. So erteilt der Energieversorger Fairnetz in Reutlingen bei neuen Solaranlagen nicht automatisch mehr eine Einspeisegenehmigung. Den erzeugten Strom können und müssen die Betreiber dann ausschließlich für den Eigenverbrauch nutzen. Für sie entfällt zudem auch die staatlich garantierte Einspeisevergütung, die auch dann gezahlt wird, wenn der Marktpreis auf oder unter die Nulllinie rutscht. Damit könnte das wirtschaftliche Konzept vieler Unternehmen, die den Umstieg auf eine Markus klimaneutrale Energieversorgung planen, ins Wanken kommen. „Die Leistungsfähigkeit moderner PV-Anlagen, die Unternehmen zum Beispiel auf dem Dach ihrer Werkshalle installieren, liegt häufig über ihrem Strombedarf“, weiß Hölzle, Vorstandsmitglied beim Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und dort Leiter des Geschäftsbereichs Elektrochemische Energietechnologien in Ulm. Das heißt: Diese Betreiber kalkulieren die garantierte Einspeisevergütung bei Neu- und Zubauten mit ein.
Wasserstoff-Beauftragter
Fällt dieses Zubrot in den sonnenreichen Monaten zukünftig weg, rechnet sich unter Umständen die gesamte Investition nicht. Denn im Winter, wenn im Extremfall eine sogenannte „Dunkelflaute“ herrscht, müssen die Betriebe dann Strom aus dem Netz beziehen - der gerade bei Dunkelflauten teuer ist. Dies spüren die Betreiber dann auch direkt, da sie meist variable Großkundenstromtarife haben und keine Festpreise wie Privatkunden. „Der Kapazitätsausbau gerade im Bereich der Solarenergie ist zwar erfreulich“, stellt Michael Frankenberger von der Energieagentur des Landkreises Göppingen fest. „Doch weil der Netzausbau damit nicht Schritt hält, führt das zu höheren Volatilitäten bei den Einspeisemengen und dementsprechend auch bei den Preisen. Das ist der Transformation nicht unbedingt zuträglich.“
Keine Klimaneutralität ohne Wasserstoff
Hölzle und Frankenberger plädieren deshalb dafür, dass der Energieträger Wasserstoff perspektivisch stärker in den Blick genommen wird.„In der Wärmeversorgung liegt der Anteil der Erneuerbaren Energien erst bei 18 Prozent“, sagt Wasserstoff-Beauftragter Frankenberger. „Soll, wie vom Land vorgegeben, bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität erreicht werden, sind erhebliche Anstrengungen notwendig. Ohne den Einsatz von Wasserstoff wird das kaum gehen. Er besitzt schließlich auch den Vorteil, dass er bei hoch thermischen Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Mit elektrischer Energie sind die notwendigen Betriebstemperaturen nicht zu erreichen oder die baulichen Voraussetzungen für entsprechende Anlagen fehlen.“
Förderprogramme sollen Wasserstoffwirtschaft ankurbeln
Land, Bund und die EU rufen regelmäßig Förderprogramme ins Leben, die dabei helfen sollen, eine Wasserstoffwirtschaft in Baden-Württemberg aufzubauen. Eines dieser Projekte ist eine Pilotanlage des Papierherstellers Essity, die der in Baden-Württemberg stark vertretenen Branche den Weg in eine CO₂-freie Produktion weisen könnte. Essity betreibt am Standort Mainz-Kostheim eine Papiermaschine, bei der sukzessive Erdgas durch grünen Wasserstoff ersetzt wird. Als grün“ gilt Wasserstoff, wenn er zu hundert Prozent mit Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugt worden ist. Mit dem Pilotprojekt sammeln Essity und das Zukunftsprogramm Wasserstoff Baden-Württemberg (ZPH2) Erfahrungen, wie durch Wasserstoff auch eine energieintensive Produktion CO2-frei gelingen kann.
Professor für Elektrochemische Energiespeicherung und Energiewandlung
Die Papierfabrik Palm geht einen anderen Weg. Sie hat ihr Kraftwerk an ihrem Standort Aalen mit einer Siemens-Gasturbine ausgestattet, die besonders effizient arbeitet und mit Wasserstoff betrieben werden kann, wenn der Energieträger über eine Leitung verfügbar ist. ZSW-Vorstand Hölzle und sein Team forschen indes an Brennzellen, die flexibel einsetzbar sind und eine höhere Effizienz für die Stromerzeugung besitzen als heutige, erdgasbetriebene Blockheizkraftwerke. „Brennstoffzellen funktionieren bereits heute sehr gut und bieten zudem noch großes Entwicklungspotential, vergleichbar mit Lithiumionenbatterien vor zehn Jahren“, so prognostiziert Hölzle.
Wasserstoff als Energiequelle erfordert jedoch eine neue Infrastruktur. Der Betrieb eines Elektrolyseurs, mit dem Wasser durch den Einsatz von Elektrizität in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten wird, ist nur an ausgewählten Standorten und nach teilweise aufwändigen erlaubt. Eine 2-Megawatt-Anlage, die pro Jahr etwa 70 Tonnen Wasserstoff produziert, ist etwa so groß wie eine PKW-Garage. Dazu kommt ein Gastank zur Speicherung des abgeschiedenen Wasserstoffs. Ein Pilotprojekt in Ebersbach an der Fils arbeitet indes an einer Alternative: die dezentrale Produktion von Wasserstoff aus Abfällen. Grundsätzlich könnten Unternehmen ihre PV-Anlagen also mit einer Wasserstoffproduktion ergänzen und im Winter entsprechende Vorräte wiederum verstromen. Der Wirkungsgrad dieser Methode ist nachgewiesen schlecht. Doch das lassen beide Experten nicht Genehmigungsverfahren gelten. „Es ist doch viel besser, die Überschüsse aus Solaranlagen oder Windkraft für die Wasserstoffproduktion als Zwischenschritt für eine spätere Verstromung zu nutzen, als diese Energie wertlos verfallen zu lassen“, argumentiert Hölzle. „Ein Batteriespeicher kommt als Alternative wegen der vergleichsweise geringeren Energieinhalte meist nicht infrage oder wird sehr groß und teuer.“ Selbst bei einem Speicher von der Größe eines Seecontainers reicht die Strommenge selten, um die Produktion länger als eine Woche am Laufen zu halten.
Professor für Elektrochemische Energiespeicherung und Energiewandlung
Generell warnt der ZSW-Vorstand jedoch vor kleinen Insellösungen. „Um Economies of Scale nutzen zu können, ist der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft mit entsprechendem Netz notwendig, in das Überschüsse wie beim Strom eingespeist und zu den Verbrauchsstellen transportiert werden. Der Grundstein dafür ist mit dem beschlossenen Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes immerhin bereits gelegt.“ Eine Hürde bleibt allerdings noch: Die Produktion von grünem Wasserstoff ist vergleichsweise teuer. Das liegt auch an den regulativen Rahmenbedingungen.

So hat die EU festgelegt, dass die Produktion - vereinfacht gesprochen - nur dann erfolgen darf, wenn auch genug grüner Strom aus Sonne und Wind zur Verfügung steht. „Dieser, Goldstandard' hemmt das Hochlaufen dieses Energieträgers“, stellt Hölzle fest. „Zielführend wäre eine Kombination aus niedrigeren Zugangshürden und besserer Förderung - so wie es auch heute mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz und der hiermit verbundenen, bevorzugten Einspeisung von Grünstrom in das Stromnetz für Windkraft und Solarenergie geregelt ist.“ Die Wissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), aber auch bei der BASF in Ludwigshafen arbeiten zudem an der Serienreife eines Verfahrens, bei dem Wasserstoff aus Methan gewonnen wird. Dieser sogenannte „,türkise“ Wasserstoff wäre in der Herstellung nur halb so teuer wie der grüne-wenn alle Nebenprodukte, die bei dem Prozess anfallen, wirtschaftlich verwertet werden. Damit wäre der Einsatz von Wasserstoff, der ganz ohne CO2-Emissionen erzeugt wurde, in vielen Industrien zeitnah wettbewerbsfähig. [!] Thomas Luther
Anlaufstelle für Wasserstoffinteressierte

ADOBESTOCK.COM SCREENSHOT: WWW.H2REGIONGP.DE
Die Energieagentur des Landkreises Göppingen unterstützt und berät Unternehmen und andere Initiatoren bei der Planung und dem Aufbau eines Wasserstoffprojektes.
Unter anderem vermittelt sie entsprechende Experten aus ihrem Netzwerk und betreibt eine Wasserstoffhomepage (https://www.h2regiongp.de/ ).
Besucher finden dort die Kl-gestützte, virtuelle Ansprechpartnerin Sophia, die alle Fragen zum Thema Wasserstoff beantwortet.

Zur Person
Bevor Michael Frankenberger im Februar 2024 bei der Energieagentur als Wasserstoff-Beauftragter des Landkreises Göppingen angefangen hat, war er Gesellschafter und Geschäftsführer eines Unternehmens in Hannover im Bereich IT-Dienstleistungen, App-Entwicklungen und Business Development.

Zur Person
Prof. Dr. Markus Hölzle ist seit Oktober 2020 Mitglied des ZSW-Vorstands und Leiter des Geschäftsbereichs Elektrochemische Energietechnologien in Ulm. Er hat die Professur für Elektrochemische Energiespeicherung und Energiewandlung an der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Ulm inne. Davor war Hölzle in verschiedenen leitenden Positionen bei BASF in den Bereichen Chemiekatalysatoren, Brennstoffzellen und Batteriematerialien tätig.

















