Werden Übersetzerinnen und Übersetzer bald überflüssig? „Kurze Antwort: Nein“, so Luisa Callejón, Vizepräsidentin des Bundesverbands der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ).„KI kann Laien als Orientierungshilfe dienen, eine professionelle, fehlerfreie und rechtssichere Übersetzung kann sie nicht liefern.“ KI sei für Übersetzungsprofis eines von mehreren technischen Werkzeugen, um vor dem Hintergrund der vielfältigen internationalen - wirtschaftlichen oder politischen - Beziehungen den weiter steigenden Bedarf an Übersetzungen überhaupt abdecken zu können.
Vizepräsidentin des BDÜ
Den Menschen ersetzen kann und wird die Künstliche Intelligenz - wie in vielen anderen Berufen ebenfalls - wohl auch mittelfristig nicht, prognostiziert die staatlich geprüfte Übersetzerin für die spanische Sprache sowie gerichtlich ermächtigte Übersetzerin und allgemein beeidigte Dolmetscherin, zumal im professionellen Zusammenhang, wo es um juristische oder für die Gesundheit relevante beziehungsweise geschäftskritische oder auch kreative Texte geht: „Auch wenn das von Branchenfremden regelmäßig vorhergesagt wird. Von der Schreibmaschine bis zur generativen KI gab es auch im Bereich des Übersetzens schon einige technologische Entwicklungen. So wie jedoch schon lange nicht mehr mit der Schreibmaschine gearbeitet wird, gehört heutzutage, wo sinnvoll, auch der Einsatz von KI als eines von vielen Tools mit zum Beruf, will man am Markt bestehen.“
KI versteht nicht wirklich

Denn grundsätzlich versteht eine Maschine nicht, was mit einer Textsequenz gemeint ist, in welchem Kontext diese steht, und bezieht auch nicht - wie der Mensch unterschiedliche gesellschaftliche beziehungsweise kulturelle Hintergründe mit ein, sondern errechnet lediglich anhand der Daten, mit denen sie „gefüttert“ wird, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, wie diese bestimmte Textsequenz übersetzt werden könnte. Bei der Textgenerierung, etwa durch ChatGPT, errechnet das Programm die Wahrscheinlichkeit, welches Wort als nächstes im Satz folgen könnte. Das erklärt auch, warum solche Programme zuweilen Inhalte frei erfinden („halluzinieren“), denn sie überprüfen dabei eben nicht den Wahrheitsgehalt.
Und: Je komplexer die zu übersetzenden Sätze, Textpassagen oder ganzen Texte sind, desto höher auch das Risiko, dass wichtige Elemente nicht korrekt übertragen werden oder gar verloren gehen. Textpassagen werden nach aktuellem Stand in der Regel als eine Aneinanderreihung von Sätzen betrachtet - ohne unbedingt einen Zusammenhang zwischen diesen herzustellen; damit potenzieren sich die genannten Ungenauigkeiten noch. Dies gilt erst recht für ganze, längere Texte.
Damit ist aus Sicht des BDÜ auch klar: Insbesondere im professionellen Kontext seien definitiv qualifizierte Profis gefragt, die die Methodik und die Feinheiten des gesamten Übersetzungsprozesses in ihrer mehrjährigen Ausbildung verinnerlicht und mit ihrer Berufserfahrung gefestigt hätten.
Als Hilfstechnologie eine Erleichterung
Teilweise könnten die menschlichen Profis mit den neuen Möglichkeiten für sich selbst auch neue Einsatzgebiete erschließen, ist man beim Bundesverband überzeugt. So würden entsprechend ausgebildete Übersetzer und Dolmetscher auch für die umfassenden Aufgaben der Umsetzung mehrsprachiger Projekte sowie zum Einsatz digitaler Arbeitswerkzeuge fundierte Expertise und Beratungskompetenz bereitstellen: „Sie wissen, wie und wann für professionelle Anwendungen entwickelte Übersetzungssysteme gegebenenfalls unter Einbindung automatisierter Prozesse sinnvoll und effizient genutzt werden können und wo sich mögliche Fehlerquellen verstecken, beziehungsweise welche Tools beim Dolmetschen unterstützend eingesetzt und in welchen Situationen welche Technik unter welchen Voraussetzungen, etwa für digitalisierte Dolmetscherprozesse, wie etwa Remote- oder Ferndolmetschen, eingesetzt werden können.“
Vorstandsmitglied des VdÜ
Und auch André Hansen gibt Entwarnung. „Es hat sich noch nicht in der Breite durchgesetzt, dass Verlage jetzt Künstliche Intelligenz systematisch einsetzen oder das von uns verlangen oder gar ganz auf uns verzichten möchten“, stellt der Zweite Vorsitzende des Verbandes der Literaturübersetzer (VdÜ) fest, der außerdem das Projekt Kollektive Intelligenz mitgegründet hat, um die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf das literarische Übersetzen zu untersuchen. Zugleich verweist der Experte auf die insgesamt schwierige Situation im Genre Literaturübersetzung, in dem viele seiner Kolleginnen und Kollegen einen wirtschaftlichen Druck beklagen, der vor allem von den Verlagen ausgeht.
Die Diskussion beim VdÜ jedenfalls ist in vollem Gang, wie Hansen beschreibt: Manche Kolleginnen und Kollegen verwenden die Technologie als Hilfsmechanismus, manche wiederum lehnen selbst das strikt ab. [!] Wilfried Urbe
Außersprachliche Risiken und Gefahren der KI
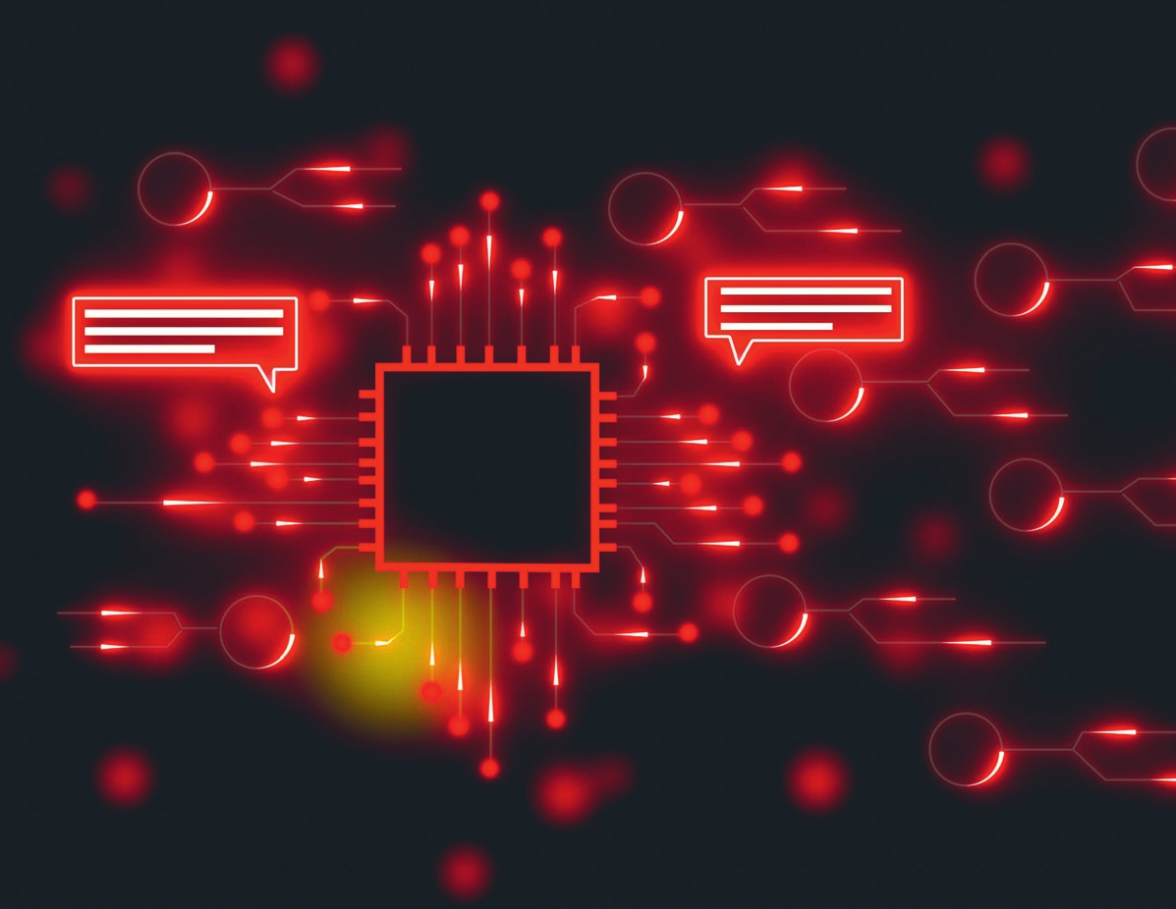
Der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) warnt, dass bestimmte Aspekte nicht außer Acht gelassen werden dürfen: Wie wird der Datenschutz sichergestellt? Für wen sind die in die Systeme eingespeisten Daten zugänglich, und wer nutzt diese und wozu? Was ist mit dem Urheberrecht an den zum Training der maschinellen Systeme eingesetzten Texte? Welche Maßstäbe liegen zugrunde, etwa mit Blick auf die eingesetzten Algorithmen, die mit eigener Logik agieren, manipulierbar sind und keiner ethischen Kontrolle unterliegen?
„Gerade in sensiblen Bereichen wie etwa Justiz, Gesundheit, Integration/Migration bietet die Integrität qualifizierter humaner Übersetzer und Dolmetscher nachhaltige Sicherheit - nicht zuletzt auch gegen die Gefahren von Cyberattacken und Manipulationsversuchen.“

Zur Person
André Hansen ist Literaturübersetzer in den Bereichen Belletristik und Sachbuch sowie Vorstandsmitglied des VdÜ und Mitinitiator des Projekts Kollektive Intelligenz.

Zur Person
Luisa Callejón studierte Hispanistik sowie Germanistik und promovierte in Neuer Deutscher Philologie an der FU Berlin. Seit 2023 ist sie Vizepräsidentin des BDÜ.

















